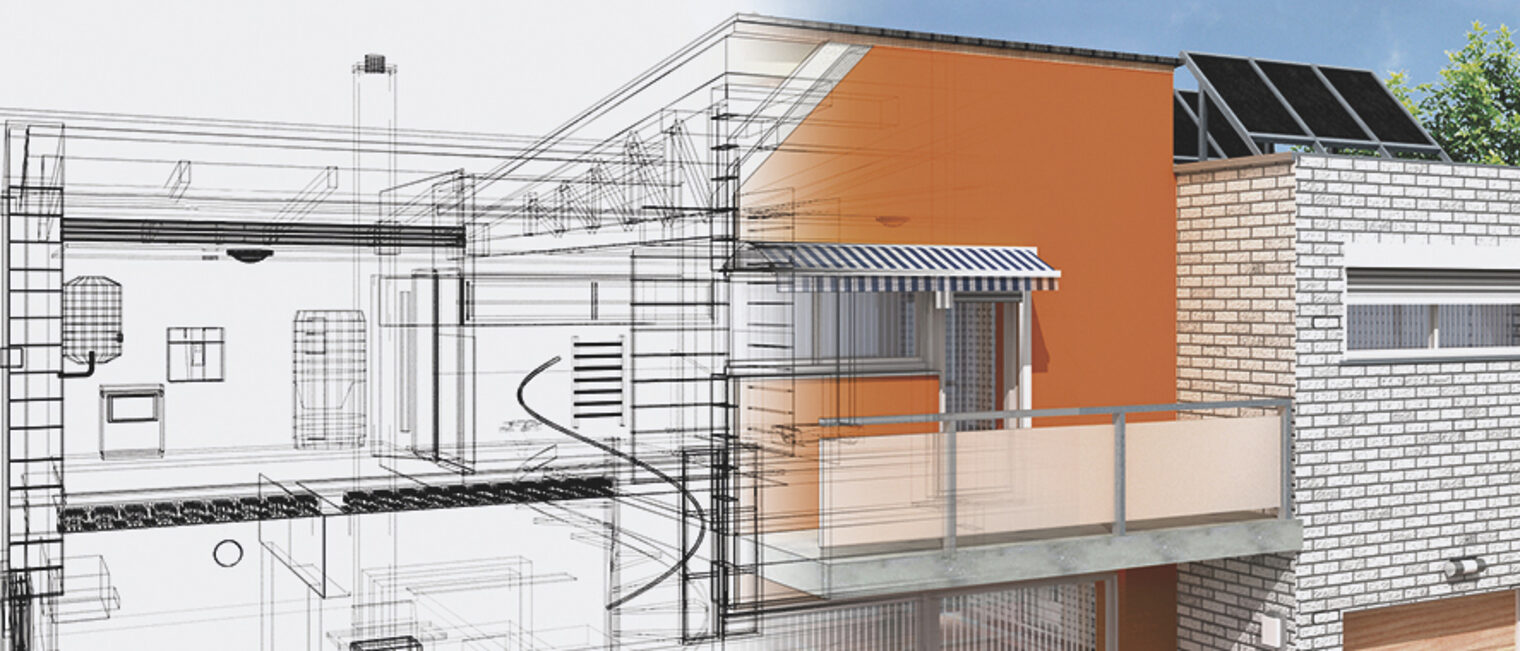
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden die energetischen Anforderungen für Gebäude geregelt. Es vereint seit 2020 das Energieeinspeisegesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Das Ziel des GEG ist es, klimafreundliche Wärmeversorgung umzusetzen, um spätestens 2045 auf fossile Energieträger im Gebäudebereich zu verzichten und vollständig mit erneuerbaren Energieträgern zu heizen. Darüber hinaus werden weitere Anforderungen an die energetischen Eigenschaften der Gebäudehülle definiert.
Die wichtigsten Regelungen im Kurzüberblick
- Neu eingebaute Heizungen, die in Gebäuden in Neubaugebieten installiert werden, müssen zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Bei Bestandsgebäuden kann gewartet werden, bis die jeweilige kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist.
- Bestehende Öl- oder Gas-Heizungen können weiter betrieben und repariert werden.
- Bis Mitte 2026 sollen Großstädte ab 100.000 Einwohnern Ihre Wärmeplanungen vorlegen und ab Mitte 2028 kleinere Gemeinden (kleiner 100.000 Einwohner). Bis zu diesen Fristen können Heizungsanlagen unabhängig der Vorgaben ausgetauscht werden.
- Die Wärmeplanung gibt Auskunft darüber, wo die Kommune einen Anschluss an ein Fernwärmenetz oder ein wasserstofffähiges Gasnetz in Aussicht stellt. Immobilienbesitzer, deren Gebäude außerhalb der Wärmeplanungsbereiche liegen oder die kein Interesse an einem Anschluss an ein Fernwärmenetz oder wasserstoffhaltiges Gasnetz haben, müssen eine klimafreundliche Heizung einbauen. Dies können unterschiedlichste Anlagen sein, wie zum Beispiel Wärmepumpen, Holzheizungen oder wasserstofffähige Gasheizung, die dann zukünftig aber auch tatsächlich an ein Wasserstoff-Gasnetz angeschlossen werden müssen.
- Für Eigentümer, die sich unverhältnismäßigen Investitionskosten gegenübersehen, gibt es Ausnahmen und Übergangsfristen. Eine unbillige Härte liegt dann vor, wenn die zu erwartenden Investitionskosten in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Immobilie stehen oder besondere persönliche Umstände keinen Heizungstausch zulassen.
- Solange noch keine Wärmeplanung vorliegt und bei der Heizung eine Havarie vorliegt, kann von einer Übergangsfrist von maximal fünf Jahren Gebrauch gemacht werden. Innerhalb dieser Zeit können auch noch rein fossil betriebene Heizungen neu eingebaut und genutzt werden. Dies allerdings nur mit einer vorherigen Beratung, die auf negative Auswirkungen wie steigende CO2-Kosten hinweist. Ab 2029 müssen alle diese Heizungen einen steigenden Anteil an Biomasse oder Wasserstoff nutzen.
Unternehmererklärung
Die Unternehmererklärung nach dem GEG ist ein wichtiger Bestandteil der Umsetzung von energetischen Maßnahmen. Sie dient dem Bauherrn und Gebäudeeigentümer gegenüber Behörden und Förderstellen als Nachweis, dass die durchgeführten energetischen Sanierungen an der Gebäudehülle und Anlagentechnik fachgerecht sowie gesetzeskonform durchgeführt wurden.
Die Unternehmererklärung ist immer dann erforderlich, wenn Arbeiten unter die Anforderungen des GEG fallen, wie zum Beispiel:
- Austausch von Fenstern oder Außentüren.
- Dämmung von Dachflächen, Außenwänden oder der obersten Geschossdecke.
- Einbau oder Austausch von Heizungsanlagen, insbesondere bei der Nutzung von erneuerbaren Energien.
- Modernisierung oder Austausch von Warmwasserbereitungsanlagen.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Energieeinsparpotenziale tatsächlich erreicht und die energetischen Anforderungen, z.B. an die Dämmung oder den Austausch von Heizungen, korrekt umgesetzt werden.
Vordrucke für die Unternehmererklärung wird vom Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum zur Verfügung gestellt:
Beratungspflicht
Das GEG schreibt für den Einbau von Gas- oder Ölheizungen vor, dass vor dem Einbau einer mit einem Brennstoff betriebenen Heizungsanlage eine Beratung durch eine fachkundige Person zu erfolgen hat. Hierbei muss hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der kommenden Wärmeplanung auf eine mögliche Unwirtschaftlichkeit, aufgrund ansteigender CO2-Preise hingewiesen werden (§ 71 Abs. 11 GEG).
Die fachkundigen Personen, die die Beratung durchführen dürfen sind:
- Schornsteinfeger/innen nach Anlage A Nummer 12 zu der Handwerksordnung
- Installateur/innen und Heizungsbauer/innen nach Anlage A Nummer 24 zu der Handwerksordnung
- Ofen- und Luftheizungsbauer/innen nach Anlage A Nummer 2 zu der Handwerksordnung
- Energieberater/innen, die auf der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes stehen oder
- anderweitig nach § 88 Absatz 1 GEG berechtigte Personen.
Informationen für den Kunden und das benötigte Formular finden Sie hier.
Energieberatung - Hinweispflicht
Das GEG stärkt die Gebäudeenergieberatung, da künftig beim Kauf von Ein- und Zweifamilienhäusern eine Energieberatung durchzuführen ist (§ 80 GEG). Zudem ist bei Sanierungen von Außenbauteilen an Ein- und Zweifamilienhäusern – wenn Berechnungen für das gesamte Gebäude nach § 50 GEG durchgeführt werden – gemäß § 48 GEG der Kunde darauf hinzuweisen, dass dieser vor Beauftragung der Planungsleistung zunächst eine Energieberatung mit einer berechtigten Person durchzuführen hat, wenn eine solche unentgeltlich angeboten wird.
In der Folge sind Handwerker, die größere Angebote für Sanierungen von Außenbauteilen abgeben, von der Hinweispflicht betroffen. Um der Hinweispflicht gerecht zu werden, händigt der Handwerker dem Kunden zusammen mit dem Angebot idealerweise ein Schreiben aus, welches auf eine solche Energieberatung hinweist.
GEG-Registrierungsstelle für die Ausstellung von Energieausweisen
Für das Ausstellen von Energieausweisen für Wohn- und nicht-Wohngebäuden müssen gem. § 88 Abs. 1 GEG bestimmte Grundqualifikationen erfüllt werden.
Ausstellungsberechtigte Personen aus dem Handwerk sind:
- Personen, die ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe ausüben oder
- das Schornsteinfegerhandwerk ausführen und die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfüllen,
- in einem zulassungsfreien Handwerk in einem der genannten Bereiche einen Meistertitel erworben haben oder
- auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt sind, ein zulassungspflichtiges Handwerk in einem der Bereiche ohne Meistertitel selbständig auszuüben.
Seit Mitte 2024 muss jeder Energieausweis und Inspektionsbericht für Klimaanlagen mit einer Registrierungsnummer ausgestattet sein, die einer natürlichen Person und einem Gebäude zuzuordnen ist. Die Registrierung übernimmt das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) mit seiner GEG-Registrierungsstelle.
Bei der Registrierung haben Sie die Möglichkeit, Ihren Betrieb anzulegen und alle ausstellungsberechtigten Personen einzutragen.
Weiterführende Informationen finden Sie im Rahmen eines FAQs auf den Seiten des DIBt.
Bundesförderungen für effiziente Gebäude
Zeitgleich mit der Novellierung des GEG 2024 wurde die Förderrichtlinie „Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen“ (BEG) reformiert. Hier wird grundsätzlich zwischen der Sanierung von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden unterschieden. Beide Fördermittelrichtungen beinhalten die Ausrichtung Einzelmaßnahmen, Anlagentechnik (außer Heizung), Anlagen zur Wärmeerzeugung (Haustechnik), Heizungsoptimierung sowie Fachplanung und Baubegleitung.
Umfangreiche weiterführende Informationen können der Fördermittelseite der BAFA entnommen werden:
Energieeffizienz-Experten der Deutschen Energie-Agentur (dena)
Handwerksunternehmen, die Heizungsanlagen einbauen oder optimieren und dazu den Förderantrag für den Kunden begleiten, müssen sich bei der dena registrieren. Übernimmt ein Energieberater die Förderantragsbegleitung, muss dieser in der Energieeffizienz-Expertenliste der dena eingetragen sein. Handwerker, die bereits als Gebäudeenergieberater in dieser Liste eingetragen sind, müssen sich nicht nochmals registrieren.
Um als Energieberater Energieausweise für Wohngebäude bei Förderanträgen ausstellen zu können, ist nach § 88 Gebäudeenergiegesetz eine „Grundqualifikation“ und eine „Zusatzqualifikation“ erforderlich.
a) Grundqualifikation gemäß § 88 Abs. 1 Satz 3 Gebäudeenergiegesetz
Unter anderem ist die handwerkliche Qualifikation (in der Regel eine Meisterausbildung) Voraussetzung.
b) Zusatzqualifikation § 88 Abs. 2 Gebäudeenergiegesetz
Als Zusatzqualifikation ist die Weiterbildung zum Gebäudeenergieberater (HWK) anerkannt.
Energieeffizienz-Experte für Nichtwohngebäude
Ein Energieberater, der für die Bundesförderung für Energieberatung im Bereich Nichtwohngebäude tätig sein möchte, hat die gleichen Voraussetzungen wie im Bereich Wohngebäude zu erfüllen und muss zusätzlich eine Weiterbildung als Gebäudeenergieberater für Nichtwohngebäude (HWK) absolvieren.


